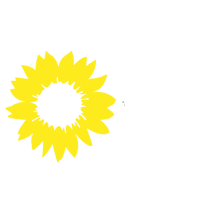Klimaschutz & Energie
Informationen zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in NRW
Mit dem Ziel Klimaneutralität 2045 hat sich das Land NRW ambitionierte Ziele gesetzt: Im Zukunftsvertrag zwischen CDU und Bündnis90 / Die Grünen haben wir ein Konzept vorgelegt, das uns als Grundlage für den Wandel hin zur modernsten und umweltfreundlichsten Industrieregion Europas dient. Nordrhein-Westfalen bekennt sich damit zu dem bundesweit festgelegtem Ziel des Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG 2023), bereits 2030 80 Prozent des produzierten Stroms aus Erneuerbaren Energien zu beziehen.
Dieses Bekenntnis zur Klimaneutralität ist wichtig, um das im Pariser Klimaabkommen festgelegte 1,5 Grad Ziel zu erreichen und die Effekte des Klimawandels abzumildern. Wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien auch, um uns von Abhängigkeiten in der Energieversorgung zu befreien und die Versorgungssicherheit unseres Bundeslandes sicherzustellen.
Ein Drittel des deutschen Stroms wird in Nordrhein-Westfalen produziert. Damit ist NRW der perfekte Standort um eine Vorreiterposition einzunehmen in der Entwicklung und Anwendung moderner Energiesysteme.
Doch wie steht es um die Energieträger der Zukunft? Was ist geplant und mit welchen Änderungen haben wir in den nächsten Jahren zu rechnen? Hier findet Ihr eine kurze Übersicht für die wichtigsten Themenbereiche:
Da sich gerade im Bereich Energie und Klimaschutz aktuell viel entwickelt, gibt es regelmäßig neue Informationen und Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene. Über diese aktuellen, oft aber auch kurzlebigen Neuigkeiten halte ich Euch in meinen Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden (Facebook, Instagram).
Außerdem möchte ich für weitere Informationen auch auf die Homepage meines Kollegen Michael Röls-Leitmann hinweisen. Er ist unser Sprecher für Klimaschutz und Energiepolitik in der Grünen Landtagsfraktion.